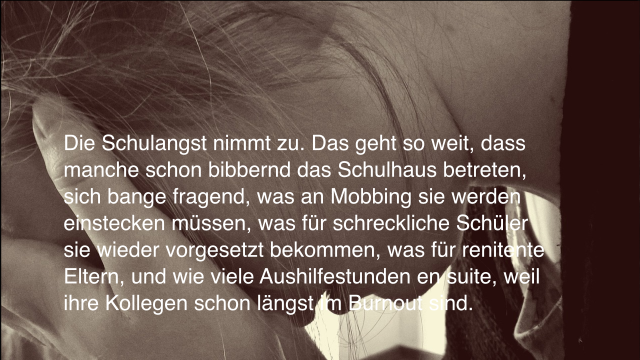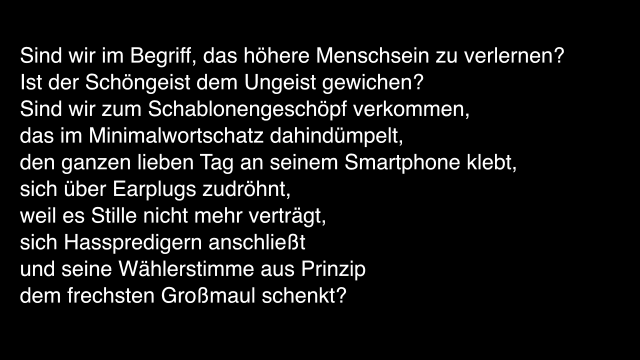Tom Ackermann ist zu seinen Wiener Wurzeln zurückgekehrt. Aus selbst Erlebtem und Erzählungen Angehöriger schmiedet er eine ergreifende wie humorvolle Handlung von den Schrecken des Krieges bis in die fetten sechziger Jahre. Der Spannungsbogen reicht von Wien bis Dresden, von Schönbrunn bis in die Voralpen, vom Filmstudio bis zum legendären Park-Kino, vom Gymnasium in die Nervenklinik. Drehscheibe des Geschehens ist die „Gloriettegasse“, in deren Schatten der Autor aufwuchs. Nichts von dem, was er erzählt, ist künstlich erdacht, bloß künstlerisch gestaltet.
Tom Ackermann ist zu seinen Wiener Wurzeln zurückgekehrt. Aus selbst Erlebtem und Erzählungen Angehöriger schmiedet er eine ergreifende wie humorvolle Handlung von den Schrecken des Krieges bis in die fetten sechziger Jahre. Der Spannungsbogen reicht von Wien bis Dresden, von Schönbrunn bis in die Voralpen, vom Filmstudio bis zum legendären Park-Kino, vom Gymnasium in die Nervenklinik. Drehscheibe des Geschehens ist die „Gloriettegasse“, in deren Schatten der Autor aufwuchs. Nichts von dem, was er erzählt, ist künstlich erdacht, bloß künstlerisch gestaltet.
Weitere satirische Zeitbilder des Autors: „Brennt Gomorrha?“, „Stirbt David?“, „Obermoos“.
Dulce et decorum est…
Lärm. Motorendröhnen. Schlaglöcher. Stechende Kälte. Schnee durch die Luken. Der Lastwagen hat bessere Zeiten gesehen. Und haltbarere Fracht transportiert. Diese kauert in Felddecken gehüllt auf Bänken, fiebernd und fröstelnd. Das Fahrzeug hält an. Die Ladeklappe geht nieder. Blick in eine märchenhaft verschneite Gasse. Gestreift gekleidete Räumbrigaden schaufeln einen Schienenstrang frei. Gewehrläufe folgen ihnen, für alle Fälle, man kann nie wissen. Also eine Stadt. Etwa schon Dresden?
Schneemänner umstellen den Wagen. Statt Karotten stechen rotgefrorene Nasen aus ihren Gesichtern und statt Besen haben sie Tragbahren unter den Arm geklemmt. Ein Weihnachtsmann mit eiszapfenbehängtem Rauschebart erklimmt den Laderaum. Er beugt sich über die bleichen Gestalten, konstatiert Leben und gibt Zeichen zum Entladen der Fracht. Wer beweglich genug ist, wird gestützt oder geführt.
Veit ist beweglich mit Einschränkung. Beim Klammern an den Haltegriff schießt Blut in den Rest seiner rechten Hand, und mit ihm Schmerz. Das Trittbrett schwankt, das Märchenland dreht sich um den Ankömmling, die Schneemänner schlagen Salti, dann verschleiern Nebel seine Sicht. Als sie sich lösen, findet er sich auf einer Bahre wieder und schwebt wie auf Aladins Teppich treppauf, einem breiten Portal entgegen. Einem Tor, das Schmerzlinderung verspricht, trägt es doch das Rotkreuzzeichen. Eine vorschnelle Hoffnung. Das Innere des Gebäudes stinkt nach verlängertem Elend. Jammer und Jodgestank schweben durch die Empfangshalle. Engelswesen in weißen oder weiß gewesenen Schürzen schwirren durch die Szene, flügellos und anonym. Es dauert, bis jemand das Wort an den Ankömmling richtet.
-Familienname?
–Wehrmann.
-Vorname?
–Veit.
-Geboren am?
–4. November 1918.
-Grund der Einlieferung?
–Wundbrand, souffliert eine Stimme im Hintergrund.
Der Fragesteller nickt und winkt eine Schwester zu sich. Sie packt die Tragbahre am Kopfende: —Dauert nich‘ mehr lang. Bald, Junge, haste dein kuscheliges Bettchen. Fass mal mit an, Anni!
Und Veit schwebt abermals, aber die Aladin-Romantik ist dahin. Er versucht, sich anderweitig abzulenken, indem er Anni fixiert, die ihnen einen Weg durch das Gewusel bahnt. Sein fiebernder Blick haftet an den prallen Gesäßbacken, die sich unter dem Schwesternkittel im Schritttakt hin und herbewegen. Die Bahre folgt dem Rhythmus auf und ab und auf und ab und auf und ab…. Veit denkt an sein kuscheliges Bettchen zu Hause, das er lange mit niemandem mehr geteilt hat. Aber vielleicht hat ja die vom Führer beschworene „Vorsehung“, die jenem kein Kriegsglück brachte, mit ihm mehr Nachsehen und begnügt sich mit einem Teil seiner oberen Extremität als Pfand. Der Rest von ihm hätte gern noch ein paar Freuden nachgeholt, wenn dieser Wahnsinn überstanden ist!
Der Transport führt einen endlosen Gang entlang, vorbei an hohen, mehrteiligen Fenstern. An den Wänden hängen zu Veits Erstaunen gerahmte Bilder in Reih und Glied, Stillleben und Federzeichnungen. Die durch die Oberlichten flutende Sonne wirft Schattengitter auf die so deplatziert wirkenden Kunstobjekte. Ihre Anordnung an der Wand folgt einem System, das Veit gern ergründet hätte, doch ist es ihm in seinem Zustand nicht möglich, sich auf Einzelheiten zu konzentrieren, Annis Arsch ausgenommen. Die Szene fließt vorbei wie eine unscharfe Filmeinstellung. Alles mutet so surreal an. Die Türen tragen befremdende Schilder: „VA“, „VIIC“, „IXB“, ganz unüblich für Krankenzimmer. Die gleichen codeähnlichen Nummern finden sich auch auf den Wänden zwischen den Bildern. Und das Kurioseste: An den Fensterscheiben erinnern Weihnachtssterne aus Goldpapier an das bevorstehende oder inzwischen schon vergangene Fest. Netter Willkommensgruß. Doch wer hat in Tagen wie diesen den Kopf für Dekorationen? Ist das überhaupt ein Spital?
Da geht die Tür auf und die Frage ist geklärt. Raum 9B ist wie erwartet mit in zwei Reihen angeordneten, teils belegten Betten gefüllt. Neben dem Eingang führen Stufen zu einem erhöhten Pult, hinter dem sich eine schwarze Tafel fast über die ganze Raumbreite erstreckt. Und natürlich (wie könnte es anders sein?) wacht habichtartig über all dem Elend das Antlitz seines Verursachers, strenger Scheitel, stechender Blick, während der Erlöser, der hier eigentlich hängen sollte, verschwunden ist. Auf eine Müllhalde oder weiß Gott wohin.
Das also wird mein Blick sein für die nächsten Tage oder Wochen. Auf das Schwein, das mir die Finger geklaut hat, und in wortlose Schwärze. Die Tafel hat ihre Sprache verloren wie die Schule ihre Schüler und Schülerinnen. Die sind in alle Winde verstreut, büffeln neu geschriebene Geschichte in Napola-Internaten, arbeiten sich die Finger wund in der Rüstungsindustrie oder üben sich an den Flaks für ihre künftige Rolle als Kanonenfutter. Jeder hat seine Rolle, nur ich, der Schauspieler, habe keine. Bei erster Gelegenheit organisiere ich mir ein Stückchen Kreide und schreibe, um dem Raum wieder seinen Sinn zu geben, einen aufmunternden Spruch von Horaz an die Tafel: „Dulce et decorum est pro patria mori“…
Schreiben? Womit?
Kommentar des Autors
In dieser Familienchronik verknüpfe ich die Schicksale mir Nahestehender wie auch von Personen, die mir über den Weg gelaufen sind, zu einem Spannungsbogen vom letzten Kriegsjahr bis in die fetten sechziger Jahre, von Wien bis Dresden, von Schönbrunn bis in die Voralpen und vom Filmstudio Hietzing zu meinem geliebten Park-Kino. Drehscheibe des Geschehens ist die Gloriettegasse, in deren Schatten ich aufwuchs. Vieles von dem, was ich erzähle, und sei es noch so kurios, ist tatsächlich an Schauplätzen geschehen, die ich minutiös beschreibe. Mein im Krieg verschollener Großvater, der bekannte Maler Franz Sedlacek, und seine Familie tragen die Handlung durch den ersten Teil. Der ist geprägt von Satire und Schwärze, wie Sedlaceks in der düsteren Wohnung hängenden Gespensterbilder. Die Erzählfigur ist mein Romanvater Veit Wehrmann. Von meinem echten Vater, der früh starb, weiß ich noch weniger, als von meinem im Krieg vermissten Großvater, meiner Tante, die mit fünfzehn an Gehirnentzündung starb und meiner Großtante mütterlicherseits, die zwar „Dresden überlebte“, aber danach nicht mehr sehr gesprächig war….
Wie viele meiner Zeitgenossen neige ich dazu, meine nicht immer rosige Kindheit zu verklären. Die in lockerer Folge aneinandergereihten Episoden des zweiten Teils, die „fetten sechziger Jahre“ also, beinhalten eine Flucht in neu erreichten Wohlstand. Um die Auf- und Abbruchzeit mit all ihren Schlagschatten zu beschreiben, bin ich in diesem Teil des Buches sowohl staunender Erlebender als auch ironisch distanzierter Erzähler – eine dramaturgische Gratwanderung. Ob sie geglückt ist, möge der Leser beurteilen.
Tom Ackermann